selbstversteckende bücher
Ruh,m
Autor: Daniel Kehlmann | Rezensiert von: Franziska Sörgel
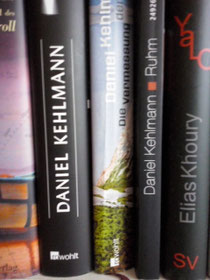
Die Geschichte, warum ich das Buch erst jetzt bespreche, obwohl es schon 2009 erschienen ist, passt gut zu diesem „Roman in neun Geschichten“. Dieser Tage war eine Freundin zum Abendessen gekommen. Sie kam mit Wein im Arm und allerhand Gastgeschenken, saß noch lange, spielte mit ihrem Weinglas und den roten Trauben auf dem Tisch, erzählte viel über Bücher, über den Verlag, damals, und nochmal übers Schreiben und immer noch kommt kein Kehlmann vor. Auch beim Frühstück nicht und beim Mantelanziehen auch nicht und dann, in allerletzer Minute, entdeckt sie ein aufwändig eingepacktes Buch in ihrer Handtasche „Ruhm“. „Ach, wie konnte ich das vergessen! Das habe ich extra für Dich gekauft, es ist das Beste, was ich je gelesen habe.“ Ich kannte das Buch nicht, hatte es nie gesehen. Die anderen schon, „F“ und die „Vermessung der Welt“, klar, jeder Auslandsdeutsche in Bolivien kriegt es irgendwann geschenkt, geht gar nicht anders. Und dann setze ich mich in den Sessel und fange an zu lesen und merke, dass ich das ganze Buch schon einmal gelesen hatte und komplett vergessen. Bis heute weiß ich nicht: Wann und wo und in welchem Exemplar. Mir fiel auch die Handlung nicht mehr ein, nichts mehr war da. In meiner Kladde mit Lesenotizen – nichts.
Das ist für mich sehr ungewöhnlich.
In einem „Spiegel“-Interview sagte Kehlmann, so lese ich später, es gehe ihm „ums Vergessenwerden, ums Verschwinden, um das Sichverlieren oder die Auflösung.“
Für Eilige fasse ich zusammen: Das Buch ist spannend, es hat 200 Seiten und zum Glück kommen ein paar Liebeszenen darin vor, sonst würde es ratzfatz als Anschauungslektüre im Deutschunterricht verheizt werden. Die Zeit der Handlung ist 2009, es spielt auf allen Kontinenten ausgenommen Australien. Männer und Frauen kommen zu gleichen Teilen darin vor.
Für weniger Eilige habe ich noch einige Beobachtungen auf Lager:
Es ist eine Versuchung für alle, die einmal zu tief in die Literaturgeschichte geschaut haben, sie („nur ein einziges Mal!“) übertreffen zu wollen. Zumindest ihre schwierigsten Formen; siehe Robert Gernhardts Sonett der Sonette. Sogenannte Erzählkränze gehören ebenfalls in diese Kategorie. So nennt man einzelne Geschichten, die in sich geschlossen komponiert sind, doch so aneinander gesetzt sind, dass sie auch als Ganzes Halt und einen – nun aber anderen – Sinn haben. Die Thora gehört dazu, das Dekameron und das Heptaméron. Jetzt haben Sie vermutlich verstanden, warum sich kaum einer an dieser Form versucht, die Latte hängt einfach viel zu hoch.
Das war Beobachtung Nummer eins. Es sind übrigens neun Erzählungen, Geschichten, Novellen, wie auch immer, die Kehlmann hier zusammenführt. Über diese Zahl können Sie bis nächstes Weihnachten googeln und finden immer wieder neue Bedeutungszusammenhänge.
Über Romane im Allgemeinen ist in der Literaturgeschichte neben klaren Ansagen, die die Form betreffen, auch vieles über ihr Sein und Wesen behauptet worden. Milan Kundera, der anfing zu schreiben, als es schon Filme gab, verlangte zum Beispiel, dass „ein Roman nur das behandeln soll, was sich nicht anders als in einem Roman darstellen lässt“. Das klingt harmlos und verschwurbelt ist aber ein Pfeil in das breite Feld der amerikanischen Bücher und Kurse zum „kreativen Schreiben“: „show, don’t tell“. Das ist der aktuelle Glaubenssatz der Buchszene, der macht, dass alles sofort verfilmbar ist. Contentmarketing, könnte man auch sagen.
Daniel Kehlmann, den man auch verfilmt hat, nur mühsamer, traut sich hingegen, seine Figuren wieder mit Gefühlen zu beschreiben: Jemand „wundert sich“ und rollt nicht „mit den Augen“, in einem anderen „flammt Empörung auf“ und er ballt nicht „die Faust“. Für diese Renaissance bin ich ihm von ganzem Herzen dankbar. (Beobachtung Nummer zwei). Apropos Faust – wer gerne rätselt, findet einige bekannte Figuren aus der Literaturgeschichte wieder, sogar der Leibhaftige erhielt eine kleine Nebenrolle.
Ein Blick von den Nebenrollen auf die Hauptfigur führt zu Beobachtung Nummer drei. Es sollte nämlich gar keine geben. „Ein Roman ohne Hauptfigur“ – ob so etwas möglich sei, überlegt einer der Protagonisten auf Seite 25 und beschreibt damit in etwa den Versuchsaufbau. Kenner des NIEMANDSLANDS denken jetzt an „Horns Ende“ und die „Landnahme“ von Christoph Hein, der gerne seine Hauptfiguren dadurch modelliert, dass er sie von einer Reihe von Bekannten beschreiben lässt, die wie in einem Museum um sie herumgehen. Doch Hauptfiguren bleiben sie ja, auch wenn sie selbst nicht zu Wort kommen.
In „Ruhm“ ist dies anders, aber auch nicht so einfach wie der Typ von Seite 25 es sich denkt. Ich sage, dass die Gesetze der Gruppendynamik auch in Erzählungen gelten und man aus jeder noch so homogen angelegten Gruppe immer ein Alphatier herausliest. Der Leserblick fällt damit ganz automatisch auf den Typ von Seite 25, der auch noch Leo Richter heißt und den Germanisten einen erzählten Erzähler nennen würden.
Kehlmann scheint das ähnlich zu sehen, sagt es aber eleganter. Mit großer Kunst bindet er aus der Leine, an der der Autor seine Figuren führt, eine gekonnte Schleife, die uns Leser durch die Schreibtischplatte mitnimmt und ab und zu zwischen den Buchseiten wieder auftauchen lässt. Kehlmanns Hauptfigur ist der Schöpfer der Story im Hintergrund. Kehlmann nennt ihn einen „zweitklassigen Gott“.
Ich denke, das genügt, um Euch neugierig zum machen, und: es gibt auch schöne Frauen darin, na klar.
Für mich ist es nun Zeit, die Gläser zu spülen, bevor der Wein darin festtrocknet. Danach räume ich das Buch in die allerhinterste Ecke. Bitte verschwinde wieder, damit ich Dich neu entdecken kann, raune ich ihm dabei zu.
Daniel Kehlmann
Ruhm
Rowohlt Verlag, Reinbek 2009
Taschenbuch, 202 Seiten
ISBN 9783498035433
19,95 €
Auf Spanisch erschienen bei
Editorial Anagrama
Unter dem Titel
Fama
ISBN 978-84-339-7514-0
